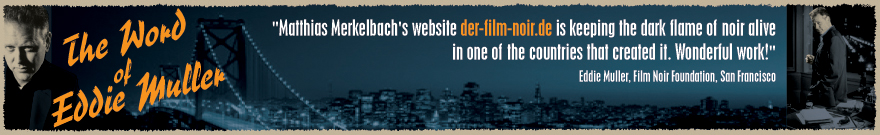Matt Dillon, Diane Lane, Tommy Lee Jones, Bruce Dern, Lee Grant
 |  |  |  |
© EuroVideo Medien GmbH
Rockport, Indiana, im Jahr 1957: In der Kleinstadt spielt Tunichtgut J.C. Cullen (Matt Dillon), genannt Cully, der bei seiner verwitweten Mutter Dorothy Cullen (Meg Hogarth) wohnt, des Abends mit Carl Hooker (Don Francks), Prager (Alvaro D’Antonio) und anderen in Hookers Autowerkstatt das Würfelspiel Seven Eleven. Weil Cullen immer gewinnt, ist Prager sauer und behauptet, dass er betrüge, weshalb es beinahe zum Streit kommt, aber Hooker kann es verhindern und beendet die Runde für heute Abend. Als letzterer den zufriedenen Cully in seinem Auto in die Stadt zurück mitnimmt, eröffnet er ihm, dass er J.C. Cullen für den besten Shooter halte, den er seit Jahren gesehen habe. Der junge Mann sagt, er habe halt Glück, aber daran glaubt Hooker nicht. Er rät ihm, nicht seine Zukunft in dem biederen Nest zu verschlafen, sondern nach Chicago zu gehen und Profispieler zu werden. Am Sonntag nach dem Kirchgang, den Dorothy Cullen ohne ihren Sohn antreten muss, teilt Roy McMullin (Sean McCann) ihr mit, dass J.C. seinen Job gekündigt habe. Dorothy fährt zu Carl Hooker und wirft ihm vor, ihren Sohn zum Glücksspiel verführt zu haben, so dass er wie sein Vater enden werde. Aber Hooker antwortet, dass Jimmy Cullen vor allem ein Säufer gewesen und dass J.C. der talentierteste Shooter sei, den er je habe spielen sehen. Kurz darauf verabschiedet sich der junge Mann von seiner Mutter und reist mit einem National-Trailways-Bus nach Chicago zu Ferguson Edwards (Lee Grant), einer Freundin Carl Hookers…
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre war Matt Dillon einer der aufstrebenden Jungstars - so wie Nicolas Cage, Sandra Bullock, Johnny Depp, Bridget Fonda, Robert Downey jr. oder Brad Pitt. Der Film ist auf ihn zugeschnitten, und er lässt sich nicht lange bitten und liefert eine alles in allem gute Leistung ab. Dabei hilft ihm allerdings ein hochkarätiges Ensemble – Lee Grant, Bruce Dern, Tommy Lee Jones und Suzy Amis sind alle fantastisch. Die Kulissen wirken im Gegensatz zu vielen historischen Neo Noirs authentisch und stilecht. Ralf D. Bodes Kameraarbeit (Dressed To Kill, USA 1980) ist hochwertig und punktet mit Nachtaufnahmen, in denen das Chicago der 50er Jahre rundum lebendig wird. Der Soundtrack beinhaltet Titel der Ära des Rockabillys und des Rhythm & Blues‘ von Little Willie John, Red Sovine, Big Joe Turner und Bod Diddley, obwohl man sich hier Fehler leistete, da die Songs von Johnny Cash und Ronnie Self erst 1958 bzw. 1959 publiziert worden waren. Nach drei Tagen wurde der ursprüngliche Regisseur Harold Becker (Mord im Zwiebelfeld, USA 1979) durch den Briten Ben Bolt ersetzt, der auf 10 Jahre als Regisseur für Fernsehserien zurückblicken konnte, doch nie einen Kinofilm gedreht hatte. In einer Szene, darin Cully und Aggie Donaldson (Suzy Amis) aus einer historischen Tram aussteigen, sieht man dahinter zwei Automobile der 70er und 80er Jahre – eine Sequenz, die nie und nimmer im fertigen Film hätte bleiben dürfen. Ansonsten gibt es nichts zu meckern. Also frage ich mich, warum trotz aller hier genannten, positiven Aspekte Chicago Blues bei mir nicht punkten konnte.
 |  |  |
© EuroVideo Medien GmbH
“You’re young, Cully. It’s a whole world out there, and you’ve just seen it through a bitty crack under the door.” Das ist ein fein in Worte gefasster Ratschlag des väterlichen Freunds Carl Hooker an seinen Schützling, der jedoch außer Coolness und Selbstbewusstsein kaum Persönlichkeit und erst recht keine Selbstzweifel zeigt. Die Figur J.C. Cullens ist einfach zu poliert und lässig, viel zu einfach gestrickt, um wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen oder gar um interessant zu wirken. Noch weniger interessant ist allerdings Diane Lane als Stripperin Lorry Dane, ihrerseits die Ehefrau des fiesen Nachtclubbesitzers George Cole (Tommy Lee Jones), denn mit ihr und ihren Platitüden nehmen die Klisches einfach überhand. In seiner zweiten Hälfte versenken der Regisseur Ben Bolt und seine Hauptdarsteller die Adaption des Kriminalromans The Arm (EA 1967) aus der Feder von Clark Howard ganz und gar im Mittelmaß. Das ist bedauerlich, denn die Produktion sieht für einige Zeit mehr als vielversprechend aus, kann aber ihr Niveau nicht wirklich über die erste Stunde hinaus aufrechterhalten und zieht viele wunderbare Einzelleistungen von Top-Schauspielern mit sich in die Versenkung. Am Ende fasst es Ryan P. Murphy für den Miami Herald nahezu perfekt zusammen: ”How easy it is to say it, but alas, it must be said: The Big Town is a big waste.”
Es gibt eine deutsche DVD-Ausgabe (2000) der EuroVideo Medien GmbH, bild- und tontechnisch einwandfrei, zudem ungekürzt, aber nicht im Originalformat sondern in Vollbild 4:3, so dass Bildteile weggeschnitten sind. Das Ganze beinhaltet den original englischen Ton und eine schreckliche deutsche Kinosynchronisation, die nicht zu empfehlen ist. Leider gibt es keine Untertitel; auch Extras finden sich bei dieser VÖ nicht. Internationale Editionen wie z.B. die US-amerikanische DVD (2005) von Sony Pictures Home Entertainment (RC 1) bieten das Werk bildtechnisch topp und auch im originalen Widescreen-Format 1.85:1 mit optional englischen Untertiteln.